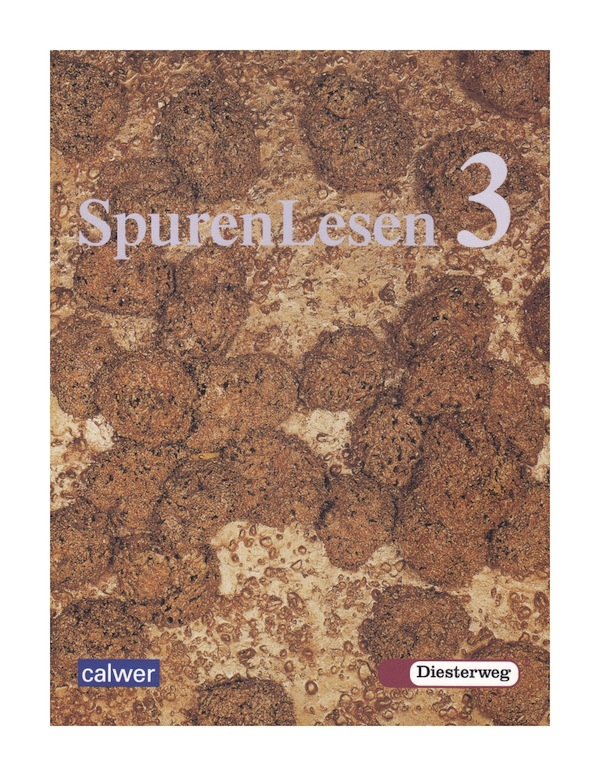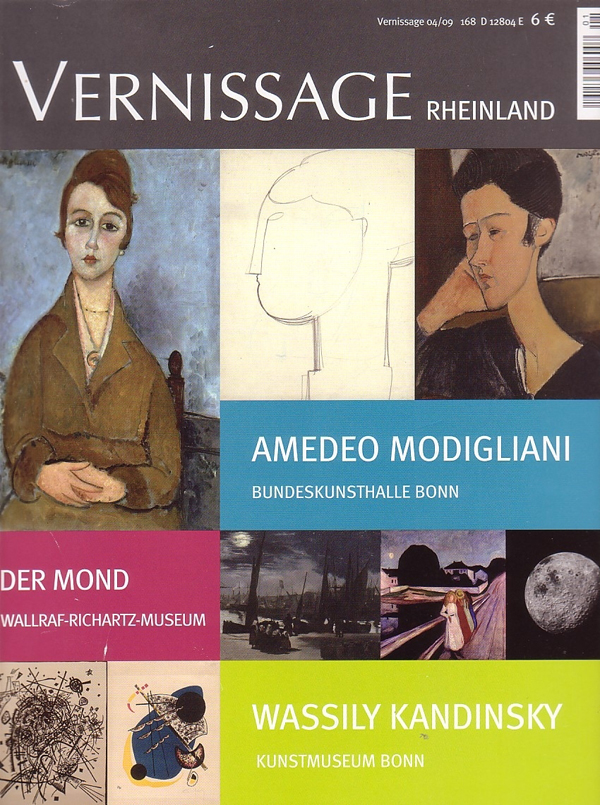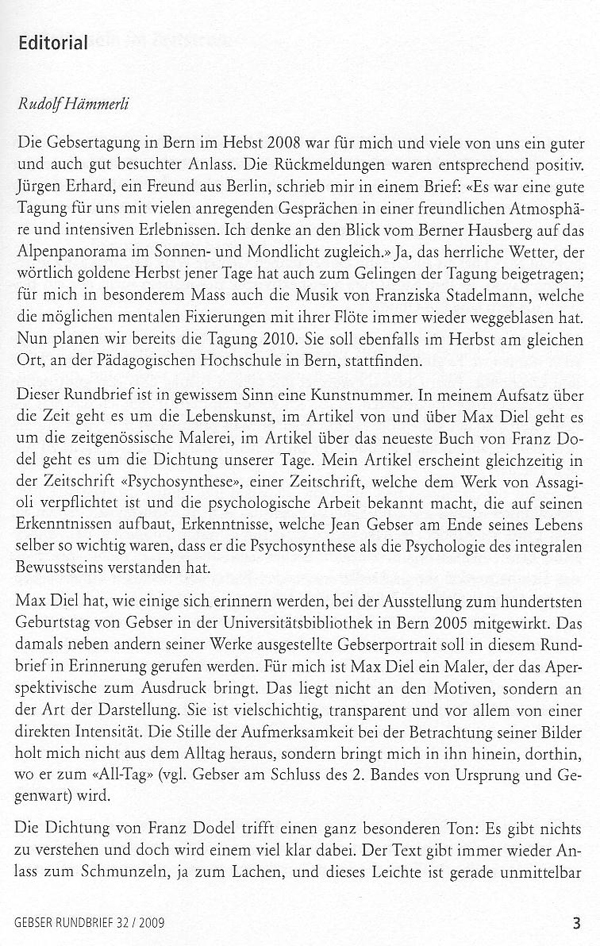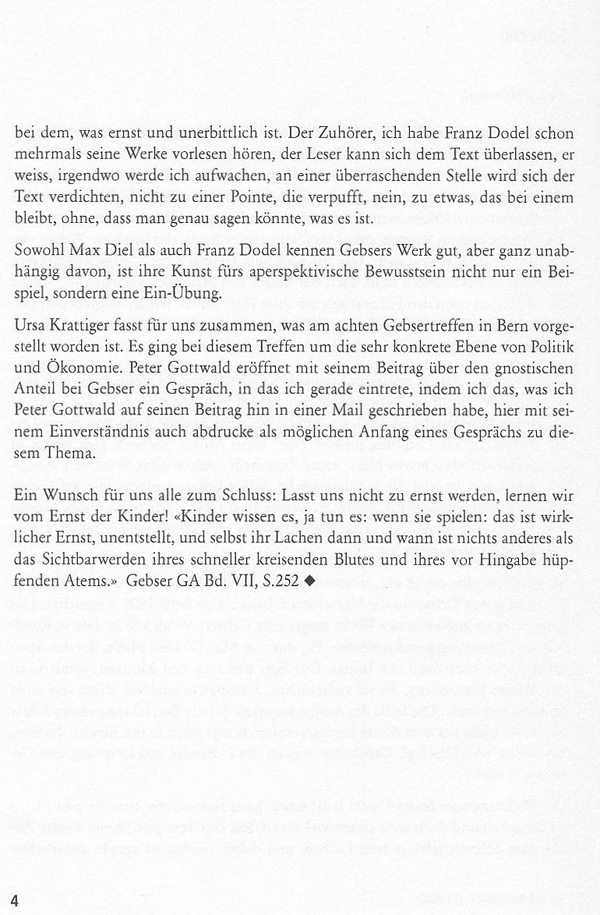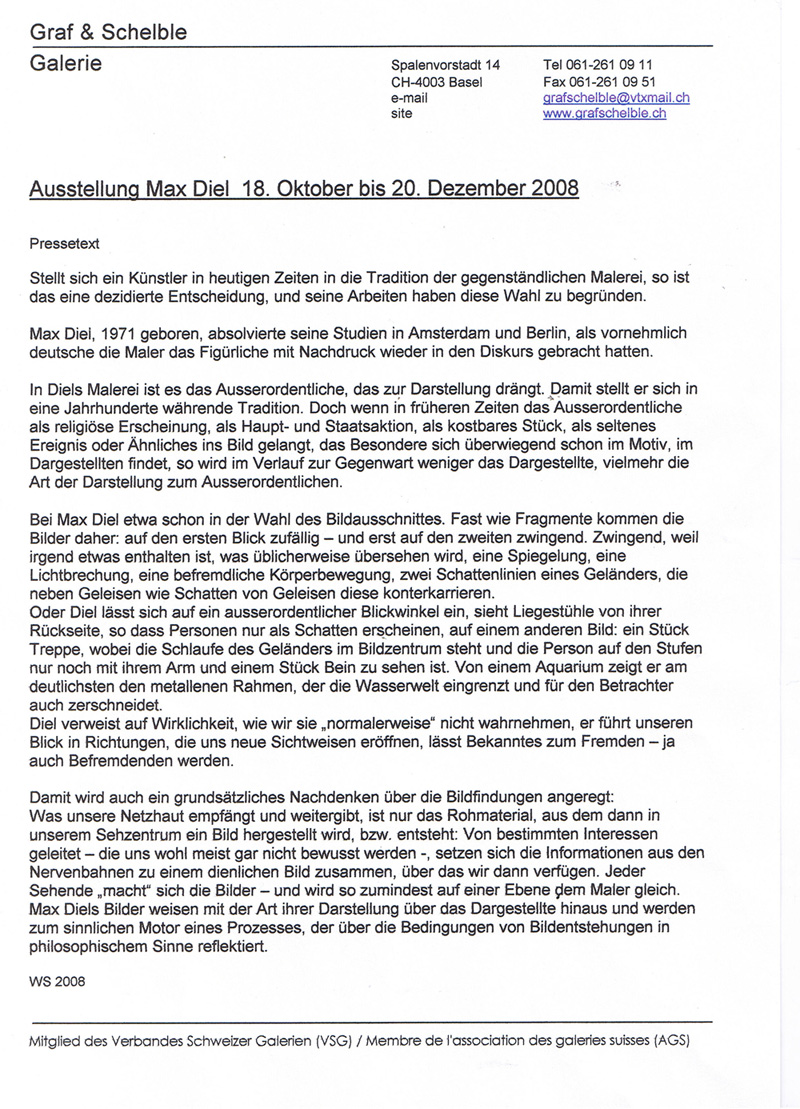Max Diel
Bibliographie

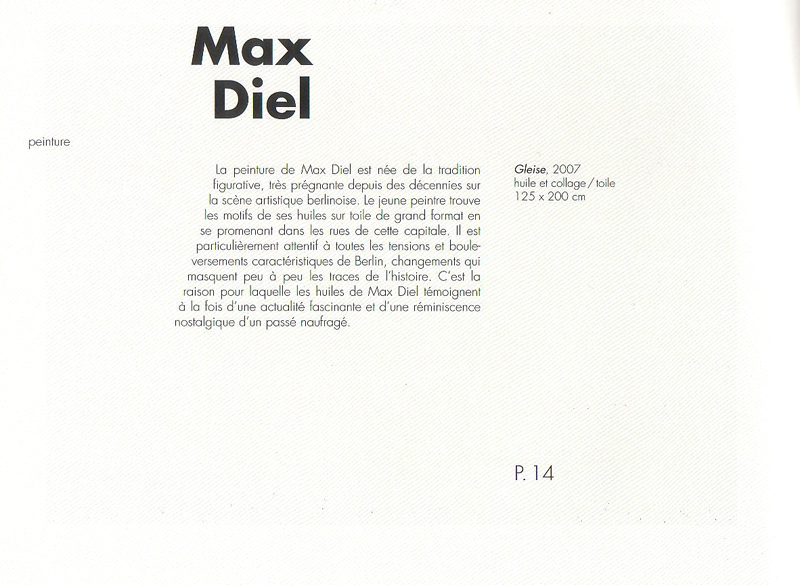

ICI BERLIN
Künstlerische Positionen aus Berlin
Marianne Stoll & Toni Wirthmüller, Beate Rathke, Stoll & Wachall, Claudia Brieske, Heather Allen, Kai Teichert, Norbert Wiesneth, Max Diel, Volker Sieben, Anne Kaminsky, Britta Lumer, Leslie Huppert, Pierre & Jean Villemin, Christine Woditschka, Matthäus Thoma, Marcus Käubler, Fernando Niño-Sanchez, Anny & Sibel Öztürk, Nadja Schöllhammer
Kuratoren:
Dr. Andrea Weber, Saarländische Galerie - Europäisches Kunstforum, Berlin
Dr. Ralf F. Hartmann, Direktor Galerie Nord | Kunstverein Tiergarten, Berlin
Als im Jahr 1989 die Berliner Mauer fiel und vierzig Jahre deutsche Teilung ein Ende fanden, begann für Berlin als wichtigste deutsche Kulturmetropole eine aufregende neue Epoche. Die Kunst aus Ost und West näherte sich einander an, unterbrochene Verbindungen wurden neu geknüpft, ein Prozess des gegenseitigen Kennenlernens begann und die Stadt wurde binnen weniger Jahre zu einem der interessantesten Plätze für zeitgenössische Kunst in Europa. Seit Jahrzehnten ist das Nebeneinander unterschiedlicher künstlerischer Strömungen, Überzeugungen und Stile der Nährboden für eine höchst vitale Kunstszene, die über viele Kontakte zu anderen Bereichen wie Musik, Theater und Literatur verfügt. An der Schnittstelle zwischen Ost und West ist die Stadt seit 1989 zu einem Magnet für Künstler aus allen Teilen der Welt geworden, die in Berlin nicht nur auf interessante Kollegen und ein aufgeschlossenes Publikum treffen, sondern für ihre eigene Arbeit optimale Bedingungen vorfinden.
Die Ausstellung ICI BERLIN zieht ein künstlerisches Resümmée der zurückliegenden zwanzig Jahre Kunst in Berlin und präsentiert über 20 Künstlerinnen und Künstler aus den unterschiedlichsten Bereichen der bildenden Kunst. Sie stellt klassische neben junge Positionen, vereinigt Malerei, Skulptur und Fotografie ebenso wie die neuen Medien, Performance- und Konzeptkunst. Alle Beiträge zur Ausstellung verbindet ein unsichtbarer roter Faden: Die Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler sind vom Umbruch geprägt, von der Suche nach aktuellen Ausdrucksmöglichkeiten und von Erfahrungen der Neuorientierung. Sie entwerfen das Bild einer neu entstehenden Metropole, die sich ihrer Geschichte und ihrer historischen Wurzeln ebenso bewusst ist, wie den Chancen des Neuanfangs in einer pluralen, multiethnischen und kosmopolitischen Gesellschaft.
Marianne Stoll und Toni Wirthmüller verbinden ihre künstlerischen Erfahrungen als Maler, Grafiker und Objektkünstler in gemeinsam entwickelten Performances. Ihre aufwändig gestalteten Kleider sind künstlerische Objekte, die während der Performances ein bewegtes Eigenleben zu entwickeln beginnen. Wie eine zweite Haut legen sich komplexe Bildwelten aus Mode, Unterhaltungsindustrie und der Medienwelt über die beiden agierenden Künstler und beginnen deren Bewegungen, Gesten und Kommunikationsformen zu bestimmen. So entsteht eine vielschichtige Metapher des menschlichen Zusammenlebens in unserer gegenwärtigen Welt, das von politischen, sozialen und ökonomischen Faktoren bedingt ist.
Claudia Brieske – Andrea Weber
Die Videoarbeit von Beate Rathke erstreckt sich über zwei Monitore im Eingangsbereich der Ausstellung. Die Künstlerin schlüpft darin in die Rolle ihres alter egos, eines virilen Cowboys, der sich selbstverliebt gemeinsam mit seinen multiplen Doubles dem Line-Dance hingibt. In der beständigen Wiederholung dieser Kunstfigur hinterfragt die Arbeit fest gefügte Geschlechterkonventionen und unseren Umgang mit Rollenklischees in einer Welt, in der die Grenzen der Identitäten zu fließen beginnen. In der Auseinandersetzung mit den Theorien der amerikanischen Kulturwissenschaftlerin Judith Butler gelingt Beate Rathke ein ebenso eindringliches wie populäres Bild des Miteinanders der Geschlechter in der postindustriellen Epoche.
Stoll/ Wachall – Andrea Weber
Claudia Brieske – Andrea Weber
Heather Allen – Andrea Weber
Kai Teichert – Andrea Weber
Der Fotograf Norbert Wiesneth zeigt in seiner Bildprojektion ungewöhnliche Blicke auf die immer mehr verschwindenden Leuchtreklamen der ehemaligen DDR, wie sie über viele Jahre das Erscheinungsbild des Alexanderplatzes im Zentrum von Ost-Berlin bestimmt haben. Seine dokumentarischen Aufnahmen entwerfen die Archäologie einer Zeichenwelt, die von verheißungsvollen Utopien und dem Wahn der Planwirtschaft bestimmt war und immer mehr vom Hauch des Untergangs umweht wurde. In der Rückansicht aufgenommen geben die eindringlichen Bilder des Künstlers den Blick auf eine surreal anmutende Welt frei, die zwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer nahezu verschwunden ist.
Die Malerei von Max Diel ist den figurativen Traditionen verpflichtet, wie sie seit Jahrzehnten die Kunstszene Berlins bestimmen. Die Motive seiner großformatigen Bilder findet der junge Maler auf unzähligen Erkundungen in der Großstadt und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf jene neuralgischen Stellen des Umbruchs, an denen sich die Gegenwart über die Spuren der Geschichte legt. So atmen die Bilder gleichermaßen eine faszinierende Aktualität, wie sie die sentimentalen Reminiszenzen einer untergehenden Vergangenheit einzufangen verstehen.
Christine Woditschkas Videoarbeit lenkt den Blick auf die wachsenden Peripherien der Metropole. In Berlin-Johannisthal, einem typischen Quartier im Ostteil der Stadt, hat die Künstlerin mit der Kamera das Terrain großer Wohngebiete sondiert. Sie verschafft uns Einblicke in soziale Strukturen und die gestalterischen Konventionen sich neu ansiedelnder und alt eingesessener Bewohner. Jenseits der dokumentarischen Qualitäten der Arbeit ist es der spezifisch analytische Blick auf gesellschaftliche Strukturen, auf Rollenerwartungen und die Bildung sozialer Identitäten, der das Video von Christine Woditschka zu einem vielschichtigen Portrait Berlins in der Gegenwart werden lässt.
Der in Kolumbien geborene Fernando Niño-Sanchez setzt sich in seiner künstlerischen Arbeit seit vielen Jahren mit den kulturellen Codierungen der ethnischen Gruppen in einer Metropole der Gegenwart auseinander. Aus gefundenen Objekten, neu entwickelten Skulpturen und Referenzen an die mediale Umwelt unserer Großstädte entsteht in seiner ausgreifenden Installation ein narrativer Faden, der sich aus unterschiedlichen kulturellen Quellen speist. Neben Sprache und Schrift, ist es insbesondere die visuelle Welt der Zeichen aus Werbung, Mode und Kommunikationsmedien, die Eingang in eine neu formulierte Bildwelt aus Verschiebungen, Paraphrasen und Kommentaren findet.
Nadja Schöllhammer verlässt mit ihren raumgreifenden Installationen die klassischen Koordinaten von Malerei und Skulptur und entwickelt dreidimensionale Bilder aus einer Vielzahl von malerischen, skulpturalen und objekthaften Formen. Wie ein Gespinst legt sich eine filigrane Bildstruktur aus Zeichnungen und Scherenschnitten als Membran in den Raum und entwickelt den Charakter einer neuen Körperlichkeit. Alltagserlebnisse, Geschichten und Mythen bilden den fragmentierten inhaltlichen Hintergrund für eine gleichermaßen anmutige wie bedrohlich wirkende Bildwelt, die sich aus vielschichtigen Reflexen unserer gegenwärtigen Lebenswelt speist.
Auf den ersten Blick betrachtet, mag man mich für einen typischen Vertreter jüngerer deutscher Malerei halten. Nach intensivem Studium der Fundamente abstrakter Malerei habe ich mich – ebenso wie viele meiner Malerkollegen - wieder dem Gegenstand zugewandt. Dabei liefern häufig Fotos und Ansichtskarten Ausgangspunkte für mein Schaffen. Die eigenständigen Bildaussagen des bestehenden Bildmaterials werden in sowohl Figurative, als auch freie Malerei, welche nebeneinander bestehen bleiben, transformiert. In soweit begreife ich mich in einer Linie mit Künstlern wie Havekost, Weischer oder Neo Rauch.
Doch gibt es bei aller Wertschätzung für diese neue deutsche Malergeneration eine Grundeinstellung in meinem Werk, die mich von meinen Zeitgenossen unterscheidet. So geht es mir nicht nur um das „Was“ und „Wie“ der Darstellung, sondern insbesondere um die innere Haltung zur Malerei, bzw zum einzelnen Bild, welches immer wieder auf´s neue kritisch hinterfragt sein will und letztlich auf eine Konkretion des Lebens abzielt.
Vor diesem Hintergrund betrachtet, erscheint mein Werk als unerwartet „sperrig“ – es offenbart sich hier eine Nähe zu Künstlern wie Dieter Roth oder Raoul de Keyser. Das Festhalten an einem Thema oder einer Malweise kann in meinen Augen bestenfalls das Resultat künstlerischen Strebens, nie aber dessen Absicht sein. Einigen mag dieses Anliegen schlicht als Unvermögen erscheinen und womöglich haben die, die in solcher Weise über mich urteilen, sogar recht. Denn der Maler, der sein Werk vollkommen beherrscht, schlägt mit dieser Meisterschaft zugleich den ersten Nagel in seinen Sarg.
Ähnliches gilt für den Gebrauch der Perspektive. Meine Bilder sind fast immer mehrperspektivisch und das wiederum in mehrfacher Hinsicht. Häufig resultiert die perspektivische Mehrfachbrechung aus dem „Sampling“ verschiedener Bildvorlagen und eigener Bild(re-)konstruktionen. Aspekte der Außenwelt, welche dem Foto entlehnt sind, werden mit inneren Bildern (Erfahrungen und Erinnerungen) gebündelt, ins Ganze gebracht. Dadurch schleichen sich immer wieder autobiographische Aspekte in die Arbeit ein – ein willkommener Anlaß, die „Echtheit“ einer Arbeit zu überprüfen. Denn nur das, was mich berührt, mag auch einen potentiellen Betrachter etwas angehen.
So, wie auch das Leben aus immer wiederkehrenden Einzelmomenten besteht, so ist auch das einzelne Bild für mich Dreh-und Angelpunkt meiner Arbeit. Mit jedem einzelnen Bild setze ich mich aufs neue mit dessen bildnerischen Möglichkeiten auseinander. Häufig spielt dabei die Beschaffenheit der Bildoberfläche eine zentrale Rolle. Manche Arbeiten sind leicht und elegant, andere wiederum zeugen von einem langwierigen, ja fast martialischen Malakt. Hier kommt oft die Collage zum Einsatz – sie öffnet neue Perspektiven. Dort, wo die ersteren Bildentwürfe scheiterten. So können sich schon mal Schlüsselanhänger, Strümpfe oder ähnliches Vorgefundenes auf meinen Bildern wiederfinden und manchem verblüfften Ausstellungsbesucher muß ich gestehen, dass ich auf die Frage: „was ist denn das?“ keine Antwort parat habe. Denn was sich im Prozeß der Einverleibung, der Verschmelzung von Außen- und Innenwelt auf der Leinwand abspielt, entzieht sich unter Umständen meiner Kontrolle.
Was dann auf der fertigen Arbeit zu sehen ist, spiegelt den Weg dieser Suche oder Reise ins Innere wieder. Es sind häufig die Spuren, welche zurückbleiben: abgekratztes und zerfetztes Papier, oder Farbschichten. Zusammengenähte, geklebte oder geschraubte Bildfragmente hinterlassen nicht selten so etwas wie Narben auf der Bildoberfläche. Sie konterkarieren das offensichtliche Streben nach einem „schönen“ Bild. Titel, wie „Walkampf“, „Ringer“, Ringer (Courbet)“, Weltensturz“ oder „Sail that ship alone“ zeugen von einer gewissen Dramatik und Verletzbarkeit.
Das Zusammenspiel von Eleganz und Aggression hat mich in den zahlreichen Schwanenbildern, aber auch bei „Zidane“ inspiriert. Das unschuldige Weiß und die offensichtliche Schönheit der Tiere bzw. Zidanes´ brillantes Fußballspiel können nicht über die innere Entschlossenheit und Härte hinwegtäuschen, die all jene erfahren, welche es auf eine Konfrontation ankommen lassen. So soll es auch dem Betrachter meiner Bilder ergehen. Man soll ruhig spüren, dass da etwas im Argen liegt.
Max Diel, 2009
Aus den Mappen quellen sie, an einem Wandvorsprung im Atelier sind sie zu finden, Bilder und Bildchen aus verblichenen Zeitschriften, Postkarten, Reproduktionen, Werbeprospekte, eine kleine Arbeitsbibliothek hütet weitere Vorlagen: Menschen, meistens Figuren, Fußballspieler, Familienfotos aber auch Landschaften, Umgebungen, Situationen. Am Anfang steht immer ein solches Fundstück. Max Diel braucht anscheinend diesen ersten Anstoß, er macht auch kein Geheimnis aus seiner Kunst des Findens, eher beiläufig hütet er ihre Zeugen, und nichts läge ihm ferner als eine ordnende Archivierung. Einen „Atlas“ gibt es nicht. Die Anwesenheit der Inspirationsquellen im Atelier ist so selbstverständlich wie die halbausgedrückten Farbtuben, wie die Wischlappen, Pinsel, Stifte und Skizzenblätter; sie bilden das Ambiente des Arbeitsplatzes. Sie sind Material der hier entstehenden Malerei, deren Arbeitsprozess womöglich mit dem Ablagern der Funde beginnt. Was in Betracht kommt, hat bereits das Stadium einer ersten Skizze, etwas das man festhalten, an dem man weiter arbeiten will, warum nicht: Eine Fundskizze. Dieses Wachstumspotential wird in einer Zeichnung abgetastet, die Möglichkeitsformen des Kommenden begeben sich auf den Prüfstand. Ein oft genug radikaler Ausschnitt fokussiert das energetische Potential der Fundskizze. Einen Projektor braucht er nicht, die neuen Umrisse werden auf der Leinwand fixiert und entfernen sich damit selbstbewusst von der Vorlage. Die Bilder und Bildchen verblassen, das Gemälde lässt seine ersten Anregungen hinter sich, je weiter es Form annimmt.
Spätestens im Umgang mit der Farbe lockert sich der Kontakt zur Fundsache. In diesem Augenblick hat sich sozusagen die Lautstärke verändert; ohnehin atomisieren die bevorzugten großen Formate den ursprünglichen Bildfund und überführen ihn in eine neue Unübersichtlichkeit. Manche Szenerien sind nur noch schwer wieder zu erkennen, oder sie wirken bewusst entstellt. Die „Wildnis“ (2006) findet im Käfig statt, der Maschendraht drängt sich ungebührlich in den Vordergrund und zerhackt den großen Raubvogel in ein nervöses Mosaik. Die Arbeit am Motiv verselbständigt sich, die Aneignung durch die Malerei produziert ihre eigene Welt. Der Blick fällt immer wieder auf souveräne Details, wo der Pinsel in einem Zug schöne Schleifen setzt; die zeichnerische Qualität der Gesten ist offensichtlich. Das Glas einer Drehtür wird gekonnt verwischt zur Demonstration von Räumlichkeit und Transparenz („Drehkreuz“ 2006). Farben begegnen sich. Der Maler hat ein Gefühl für aparte Mischungen entwickelt. Unter dem sondierenden Mikroskop des Betrachters ist sozusagen ‚Farbfeldmalerei’ zu sehen, auch beim Zurücktreten bleiben diese Inseln bestehen. Manchmal scheint das ganze Bild Ergebnis eines unmittelbaren, ungeteilten Zugriffs zu sein, es gibt eindrückliche Studien über Licht und Schatten, die eine geradezu nachmittägliche Wärme ausstrahlen; wenn etwa eine charakterstarke Weide diagonal in die Bildfläche, sprich über das blaue Wasser ragt, das durch dunkle Schattenfelder leicht bewegt erscheint. Dann ist zuallererst ‚Landschaft’ angesagt, das Figürliche meldet sich ohne Widerstand, - der Ausschnitt ist in die Totale zurückgetreten. Ein Film läuft ab und bleibt im richtigen Augenblick stehen, die Kamera unterbricht einen Schwenk. Beim genauen Hinsehen wird hinter den hängenden Ruten eine seltsame Irritierung ausgemacht, ein fleischfarbenes Körpergebiet, mutwillig getarnt, vielleicht auch übermalt im Rahmen einer ikonografischen Umorientierung. Die Großzügigkeit der Szene ist womöglich nur vorgetäuscht.
Es mag bevorzugte Themen oder Reize geben, die nach einem Bild von Max Diel rufen, etwa (rhythmisierte) Körper, Wasser, Licht und Kurven, Augenblick und Stillstand, die optischen Echos der Schatten. Alltägliches und Zufälliges findet sich wieder in großen Formaten. Durch die Malerei scheinen die Motive jeweils in eine durchaus ähnlich klingende soziale, gelegentlich auch surreale Anmutung hineinzuwachsen, die zu der womöglich falschen Vermutung verleitet, es gäbe für alle Funde von Max Diel so etwas wie einen common sense. Die eigene Handschrift, letztendlich der fertigen Arbeit, produziert naturgemäß diese und ähnliche Rückprojektionen. Es sind auch nicht immer Postkarten, Familienfotos oder Ausschnitte aus Zeitungen oder Illustrierten, die ihn zum Malen verführen. Paraphrasen und Anlehnungen an die Kunstgeschichte sind möglich, es fallen im Gespräch schon mal die Namen von Vallotton, El Greco, Hodler auch Hitchcock. Die „Dacharbeiter“ von 2007 verweisen auf Caillebotte, freilich waren die Protagonisten dieses Schlüsselbildes ursprünglich Bodenschleifer. Die Paraphrase kommt von Anfang an als Deplatzierung daher. Auch wenn die figurale Disposition und der Ausschnitt des Originals im Wesentlichen unberührt bleiben, stellt der freie Umgang mit diesen Faktoren sicher, dass ein neues Bild kommt. Ansonsten ist Caillebotte in diesem Fall eine Vorlage wie viele andere und hat zu einer offenen Skizze, zu einem zeitgenössischen Gemälde geführt, bzw. verführt. Die Vorlage bindet nicht, verschiedene Motive kreuzen sich, sie werden ineinander verschoben.
Nur Bilder, die sich selber kritisch beäugen, machen heute noch einen Sinn, die Kunst kann im tagtäglichen Geben und Nehmen keine selbstzufriedenen Elaborate gebrauchen. Ein abwägendes Innenleben muss das Rückgrat aller Malerei sein. Das gilt für alle Bilder, die heute gemacht werden, egal ob sie figürlich oder abstrakt daherkommen. Die wie auch immer gestellte Frage: Was bin ich? wird vom Bild an die Betrachter weitergegeben. Der produktive Zweifel ernährt dementsprechend auch die Arbeit von Max Diel, ja, die Vorlage wird bei ihm gelegentlich (fast) zermalt! Dann verdickt sich die Farbe, das Material stöhnt. Da scheint einer zu modellieren, der Pinsel beißt zu, das Bild bleibt stecken. Max Diel greift zu deutlichen Mitteln. Er collagiert, er pflastert, die Malerei wird partiell neu erfunden. Er schneidet Figuren oder Details aus, er setzt Schablonen in das Bild, er übermalt sie. Neue Ebenen konkretisieren sich damit, ein zusätzliches Relief konkurriert mit der Farbe, die in der Regel doch dünn und eher flächig auftritt. Anders gesagt: Das Flachbild wird gesprengt. Die rein malerische Geste relativiert sich, manche der schönen Kurven werden richtiggehend vergewaltigt durch eine trotzige plastische Chirurgie auf der Suche nach exterritorialen Lösungen.
Die Collage will anecken, sie tritt auf, als sei sie mit einer überdimensionalen Nagelschere geschnitten; beim Basteln am imaginären Küchentisch, oder, um den wuchernden Assoziationsketten noch weiter freien Lauf zu lassen: Als hätte Frankensteins Monster sich zur Hausfrau gemausert, die hier scheinheilig Wäsche aufhängt. Die Malerei balanciert am Abgrund, sie spricht ihr Urteil über der Vorlage, die sie nicht mehr abschütteln kann. Die Idylle kriselt. Eine triviale Szene maskiert sich mit dem Mut der Verzweiflung, die Frau mit der Wäsche wird zum Opfer eines Exempels, bzw. zur Vorzeigefigur einer durch und durch ehrlichen Arbeit („Wäscherin I“, 2007). Dabei wirft der Malakt die humpelnde Figuration fast aus der Kurve und produziert seine eigene, attraktive Katastrophe. Die Narben werden mit stolzem Schmerz gezeigt. Sicher ist, dass aus dem Diskurs der Farben mit dem initiierenden Konzept der Vorlage ein unabhängiges Wesen herauskommt, und das ist auf seine Weise vielleicht sogar abstrakt, als Ergebnis eines ausufernden Malvorgangs. Im Verhältnis zur Vorlage entsteht fast so etwas wie ein Phantombild.
Der kritische, wie mitfühlende Betrachter verweilt bei solchen medialen Baustellen mit besonderer Vorliebe, weil sie einen charakteristischen Blick ins Innere freigeben. Außerdem schreibt sich hier die Zeit auf eine geradezu dramatische Weise in die Materie ein. Der Verarbeitungsprozess setzt seine Zeichen und deformiert die vorfertige Erinnerung. Der Essay gefällt sich in der überproportionalen Wahrnehmung solch heftiger Auseinandersetzungen mit der Vorlage, der Bildvorstellung und dem Material. Diese plastische Chirurgie lässt den gefälligen Blick über ihre Collagetechnik stolpern. Diejenigen, die das bislang vielleicht noch gar nicht bemerkt haben, sehen plötzlich nur noch das, die Narbe im Gesicht des Gegenübers. Und beim Blick zurück über den Rest des Bildes finden sich immer mehr Verwerfungen, eingebettet in das Relief der Malerei; unter der Oberfläche rumort es. Nicht immer bluten diese Bilder freilich so heftig, nicht immer malt Max Diel die Wunden des kriselnden Arbeitsprozesses. Das Grundvertrauen in die per se heilende Kraft der Malerei führt in den meisten Fällen zu ungebrochenen Lösungen, die teilhaben an der Vielschichtigkeit seiner Arbeit. Dann zeigt Diel sich verwurzelter, stiller und, was anrührt, ist gerade die Schönheit und der Reichtum des Lebens. Doch ist die Collage als Verstärkung und Herausforderung seines Ausdrucksbedürfnisses in den letzten zwei Jahren immer wichtiger geworden.
Die Wunden des Arbeitsprozesses, ihre ernsten wie ehrwürdigen Tragödien im heroischen Kampf um das Bild, produzieren manchmal auch heitere Gegenspieler, es kommt zu ironischen Übertreibungen. Ein Herr hängt Socken auf das Trockengitter. „Am Fenster“ (2005). Das Bild ist von einer seltsamen auch weichen Präzision, der illustrative Ausschnitt scheint aus einer Vorstadt-Reportage entnommen. Die stille Nachmittagsszene gerät auf eine schiefe Ebene, wenn klar wird, dass die Socken, die da auf der Leine hängen, echt sind; deshalb erlaubt sich der Untertitel auch den Hinweis „Sockenbild“. Die Realien, die hier eigentlich ideal platziert erscheinen, brechen die Malerei auf, die ironischen Requisiten bilden eine fruchtbare Irritation, die auch den figurativen Charakter in Frage stellt.
Die unscheinbaren Textilien, werden nicht eingemeindet, sie wirken viel eher wie falsche, jedenfalls zu laut gespielte Töne im großen Orchester. Was als Kosten-Nutzen-Rechnung eine Einzahlung auf das Konto des Hyperrealismus sein könnte, also echte Textilien in einem gemalten Bild, bringt die Bildrealität letztendlich zum Einsturz, weil zwei Strategien aneinander stoßen und sich dabei gleichsam neutralisieren. Das Bild wird zum anziehenden Wechselbalg, die Malerei sitzt zwischen den Stühlen. Eine andere lustvolle Übertreibung bedient sich wieder ganz unverkrampft in den Arsenalen der Kunstgeschichte. Eine Ikone wird als Bild im Bild („Ikone“ 2005) zitiert. Die Gesichter der Muttergottes und des Kindes sind ausgespart für eine abgehobene, patinierte Malerei, eine Doublierung hinter den ovalen Fenstern. Das ganze sie umgebende Feld, die Umgebung mit ihren souveränen Malkurven bildet im übertragenen Sinne ein Ornat, das die beiden stillen Porträts schützend und schmückend umgibt. Und neben der Anspielung auf die Ostkunst und ihre Heiligen, schleicht sich auch die Assoziation an Bilderwände, an Jahrmarktsattraktionen von gestern ein, die ein Loch für den eigenen Kopf frei ließen, damit man sich als Alexander der Große oder Napoleon fotografieren lassen konnte. Ist das, mit ihren heiteren, tragischen und assoziativen Brüchen noch Malerei, die sich aufs landläufige, allgegenwärtige Parkett der vielgeliebten, neuen Gegenständlichkeit bewegt?
Auch wenn das Wort ‚schön’ hier fahrlässigerweise schon gebraucht wurde, Max Diel malt keine schönen Bilder. Seine flüssige Technik, die von der gewählten Vorlage gelenkt, leichte, offene, ja entwerfende große Flächen bewältigen könnte, wird von einem kritischen Bewusstsein kontrolliert. Und da, wo das offensichtliche Grundvertrauen ungebrochen erscheint, hat zuvor vielleicht schon der Ausschnitt mit dekonstruktivem Mutwillen gewaltet und seine deutliche Vorliebe für Zwischenräume ausformuliert. Die Selbstkritik ist Teil der produktiven Irritierung; deshalb auch das gelegentliche Wüten über einigen schweren Stellen. Gesucht wird ein autonomes Wesen, das, angestoßen von einem Fundstück, zum medialen Eigensinn der Malerei führt. Lösungen wie aus einem Guß sind möglich, die Quadratur des Kreises ist schwer zu treffen, Botschaften über die Immanenz des Mediums hinaus, ziehen sich zurück und hallen doch in den Wahrnehmungsprozess. Bei aller Abstraktion, die sich mit der (verbalen) Bildbeschreibung, mit dem Aufspüren der Arbeitsprozesse einstellt, bleibt der Gegenstand ein primärer Orientierungspunkt. Es gibt freilich Grade der Entfernung davon, wenn man einmal davon absieht, dass die Vorlage als ‚Bild’, als Reproduktion bereits einen vermittelten Status repräsentiert. Ein Paradox kann aufgespürt werden: Ein Anlass, eine Situation muss stark genug sein, um Material für die Kunst des Findens zu sein, doch wenn aus der Fundskizze endlich ein Gemälde geworden ist, darf die Malerei selbst nicht durch die Prähistorie des Motivs gestört werden. Allenfalls der Titel kann noch ein wenig darauf verweisen. Die offensichtliche Figürlichkeit dieser Bilder verstummt, und das ist ein Teil ihres Geheimnisses.
Reinhard Ermen
Badische Zeitung, Freiburg, 03.12.2007
Aus: Ein Vorfall mit Hasenohren und andere Forschungen
Autor: Volker Bauermeister
... Für den Maler Max Diel wird eine Drehtür zum Einstieg in ein undurchdringliches Raumbild.
Der Sonntag, Freiburg, 09.12.2007, (Kultur in der Region)
Aus: Die Mischung sei Kunst
Autor: Andrea-Silvia Végh
...Mit der Illustration zweier Lieder, eines im Fußhandvideo von Peter Bosshard und "tout les filles des Limatquai" von Christian Schmidt sowie und Max Diels ausgezeichnetem "Malerbildnis" ist den Juroren ein guter Coup gelungen."
Ich male stets solange an einem Bild, bis es für mich "wirkt". Damit meine ich, dass das Bild mich in irgendeiner Weise überrascht, dass es rätselhaft wird, Fragen aufwirft, Suggestionen hervorruft. Oft erkennt man das Motiv meiner Arbeiten erst auf den zweiten Blick. Der Zeitraum, den man zum Erkennen und Begreifen eines Bildes benötigt, ist mir durchaus wichtig. Er gehört in meinen Augen zum Wesensmerkmal von Malerei. Ein gewöhnliches Foto z.B. kann ich in aller Regel recht schnell erkennen - doch dafür hält seine Wirkung in mir weniger lange an. In der Malerei benötige ich oft mehr Zeit - ich brauche länger, um ein Bild in mich aufzunehmen. Doch dafür klingt es anschließend auch länger in mir nach. Es gibt Bilder, Malereien, die schon seit etlichen Jahren in mir nachklingen, oder eben: "wirken". Ich interessiere mich in erster Linie für jene Kunst, welche mich in solcher Weise überrascht, irritiert, herausfordert.Malerei erschafft Wirklichkeit neu. Es gibt Momente, da glaubt man in Gemälden ein bestimmtes Detail überaus plastisch und realistisch vor sich zu sehen. Doch bewegt man sich auf das Bild zu, erkennt man, dass alles eben doch "nur" Farbe ist. Dies gilt übrigens für abstrakte, wie gegenständliche Kunst gleichermaßen.Ein Blatt Papier, in welches ich ein Loch schneide, wird zum Objekt. Dieses überaus klassische Phänomen der modernen und zeitgenössischen Kunst fasziniert mich immer wieder aufs neue. Ähnliches läßt sich auch über Farbe und Farbmasse sagen. Oftmals spiele ich mit der Struktur und Beschaffenheit der Bildoberfläche. Zuweilen collagiere, schraube, niete oder nähe ich Dinge auf die Leinwand; auf meinen Papierarbeiten wird das Papier zum Material, oft treibe ich das Papier an die Grenze seiner Belastbarkeit.Doch scheue ich mich davor, zu sagen: "meine Arbeiten handeln vom Objektcharakter der Malerei", oder von : "Realismus", "Komposition", "Perspektive", "Farbauftrag", "Figuration-Abtraktion" oder was auch immer. Meine Bilder sind immer alles zugleich. Sie sind Möglichkeiten, "Welt" darzustellen, Bedeutungsebenen aufzuweisen.So wird eine Arbeit für mich interessant, wenn sich verschiedene Bedeutungsebenen durchdringen, wenn sozusagen verschiedene Welten zusammenkommen. Nicht immer lassen sich die Bedeutungsebenen direkt und unmittelbar ablesen. Oft braucht es Jahre, bis ich eine Arbeit richtig deuten oder schätzen kann. Nicht selten werden Arbeiten durch das Leben selbst bestätigt.
Ich versuche in meiner Kunst , die Sinne für das Zufällige zu schärfen. Wenn ich an einem Bild arbeite, bin ich bemüht, so weit wie möglich absichtslos zu bleiben. Wenn ich zuviel will, bin ich der Entstehung des Bildes im Wege. Zuwenig zu wollen, reicht natürlich auch nicht aus. Es geht um das rechte Maß. Immer wieder versuche ich, die Grenzen meiner Bildideen auszuloten, mit jedem Bild "neu anzufangen". So entstehen oftmals Bilder in meinem Atelier, welche in meinen Augen durchaus funktionierende Bilder sein könnten, jedoch eine gewisse Unsicherheit in mir hervorrufen. Dies ist ein sehr delikater Moment - wann ist ein Bild wirklich gelungen, wann übernehme ich sozusagen die volle Verantwortung für das Werk?
Auch wenn es sich banal anhören mag, ist es so, als kaufe man sich ein neues Kleidungsstück und stünde nun mit diesem vor dem Spiegel. Die entscheidende Frage ist: "Will ich so sein, will ich so gesehen werden?" So stehe auch ich mit prüfendem Blick vor dem Gemälde und frage mich: "will ich, dass dies ein Bild von mir ist?"
Folglich arbeite ich so lange an dem Bild, bis es "zu mir spricht", beseelt, eigenartig wird, will sagen : ein eigenes Leben zu besitzen scheint und ich es als direkten Ausdruck meiner Selbst erkenne.
Dieser Prozeß kann sehr schnell und mit großer Leichtigkeit vonstatten gehen oder aber er verläuft mühevoll und schwer.
Januar 2006